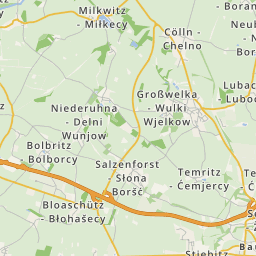
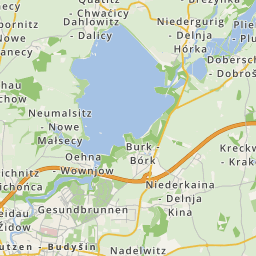

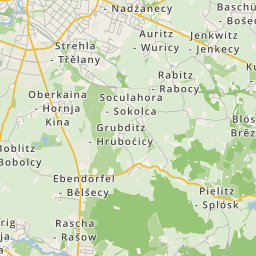
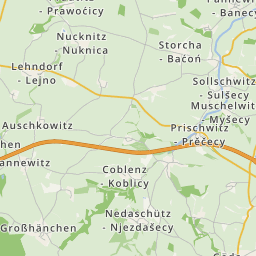



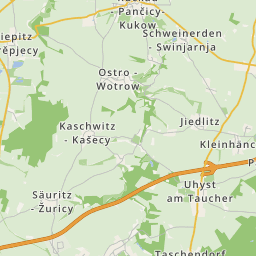


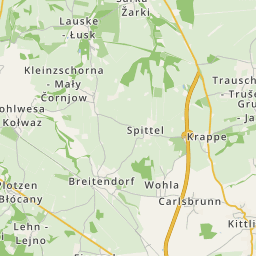
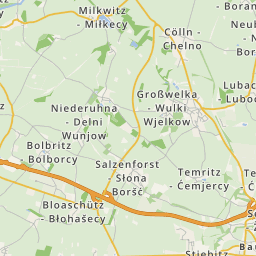
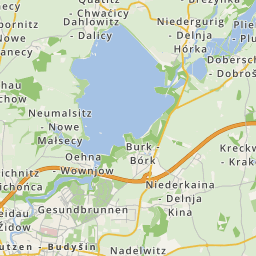

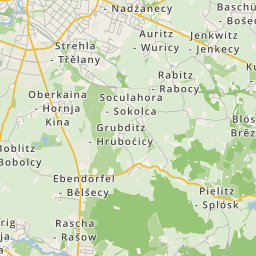
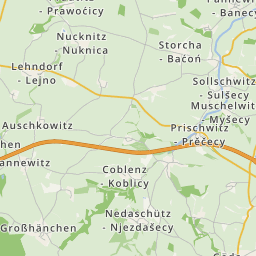



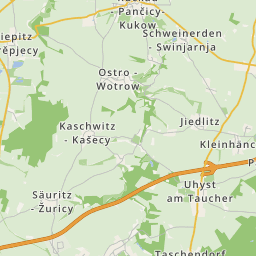


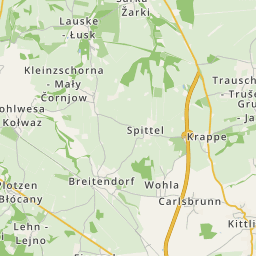

Das Bedürfnis Erinnerungsmale zu setzen lebt bis in die heutige Zeit fort. Die hier aufgeführten sind die häufigsten Gestaltungsformen und Errichtungsgründe.
Sühnekreuze stammen ca. aus dem 13. - 16. Jh. und sind Denkmale des mittelalterlichen Rechts. Sie waren Erfüllungsteil von Sühneverträgen, zwischen zwei verfeindeten Parteien, um Blutfehden wegen Mordes oder Totschlages zu beenden. Auf Ihnen sind nur Bilder der Mordwaffe oder berufstypische Geräte des Getöteten abgebildet, da Bauern nicht lesen konnten. Mit Einführung der Handelsgerichtsordnung unter Kaiser Karl V. wurden Sie "offiziell" abgeschafft. Aber
erst das 17. Jh. räumte endgültig mit Ihnen auf.

Steinkreuze sind wie der Name schon sagt, in kreuzform gehauene Steine. Diese sind nach bzw. im 16. entstanden. Sie wurden als Wetter-, Pest-, Sationskreuze von Pilgern und Prozessionen oder als Grenzmarkierungen von Kirchenparochien gesetzt.

Kreuzsteine können die unterschiedlichsten Entstehungsgeschichten haben. Einige von Ihnen lassen sich z.B. den Sühnekreuzen zuordnen, sie weichen nur in der Grundform ab. Dies kann aber auch regionale Gründe haben oder vom Vermögen des Stifters abhängig gewesen sein.

Mord- und Denksteine wurden seit dem 16. Jh. gesetzt. Diese sind meist mit Bildern, Worten und Datierungen versehen. Sie verweisen auf ein bedeutendes oder dramatisches, regionales Ereignis hin, wie tragische Unglücksfälle, hinterhältige Morde aber auch freudige Anlässe wie Erlegung des letzten Bären, Luxes oder Wolfes der Region.

Bildstöcke, Martern, Betsäulen wurden im späten Mittelalter aus unterschiedlichsten Gründen errichtet. Einige volkstümliche Bezeichnungen sind "Gerichtsmarter", "Mordmarter" oder "Hagelmard". Diese Bezeichnungen geben meist schon einen ersten Hinweis auf den Anlass zur Setzung. Das Fortleben und Ausgestalten des Bildstockthemas geht durch die Jahrhunderte.