

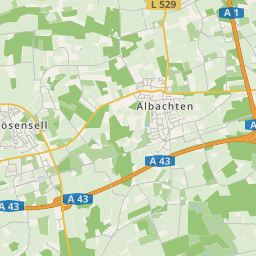
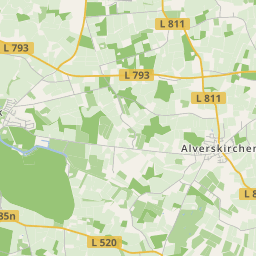
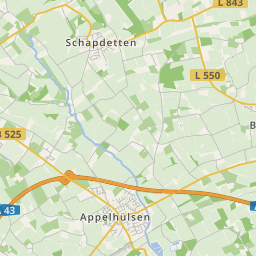
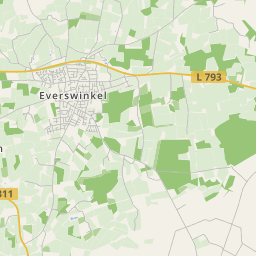


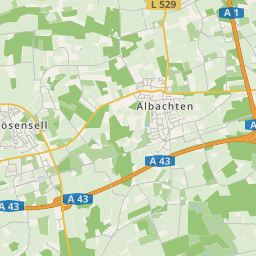
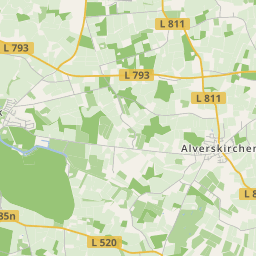
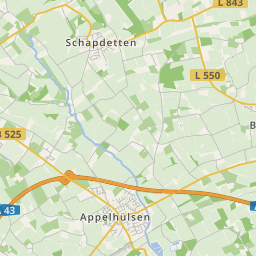
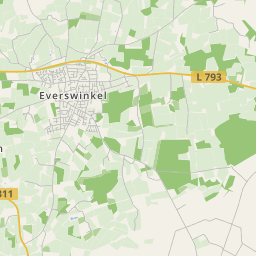

Hiltrup liegt etwa 6,5 Kilometer südlich der Innenstadt Münsters. Es grenzt (im Uhrzeigersinn, beginnend im Südwesten) an Amelsbüren, Vennheide, Gremmendorf, Angelmodde , Albersloh und Rinkerode .Geprägt wird das Ortsbild durch den Dortmund-Ems-Kanal sowie durch die Industrieanlagen der Firma Glasurit, jetzt BASF Coatings, und des 2002 stillgelegten Rockwool-Werkes (bis 1985 Basalan-Isolierwolle GmbH), dessen hoher Kamin noch heute besteht. Da in Hiltrup viele berufstätige Pendler wohnen, die täglich mit dem Auto an- und abreisen, und der Ort zudem durch die B 54 und die Straßenverbindungen nach Amelsbüren, Wolbeck und Angelmodde eine zentrale Lage für den Durchgangsverkehr hat, kommt hier zu Stoßzeiten auf einigen Straßen ein hoher Verkehr auf. Um den bebauten Innenbereich Hiltrups herum finden sich heute noch zahlreiche landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie weiträumige Waldgebiete.

Erste Siedlungsspuren in Hiltrup lassen sich bis in die Zeit um Christi Geburt zurückverfolgen. Zu dieser Zeit lebte im Münsterland und auch in Hiltrup der germanische Stamm der Brukterer. Hiervon zeugen Pfostenspuren und eine gefundene Herdstelle auf der Kanalinsel des Dortmund-Ems-Kanals im Süden des Stadtteils. Etwa 400 Jahre später, nachdem sich die Sachsen auch im Münsterland ausgebreitet hatten, bestand Hiltrup aus den Bauernschaften Sonneborn, Wentrup und Geest. Die Hohe Ward war zu dieser Zeit ein gemeinsam genutztes Waldgebiet.Um das Jahr 800, als Liudger im Auftrag Karls des Großen die vormals sächsischen Gebiete im Münsterland christianisierte, errichteten die rund 120 Einwohner der drei Bauernschaften die erste Kirche auf dem Grundstück des Bauern Schulze-Hiltrup. Im Jahr 1160 folgte der Bau der romanischen Kirche St. Clemens an der heutigen Westfalenstraße. Für das Jahr 1233 ist der Name Hiltrup das erste Mal urkundlich belegt.Die erste Schule in Hiltrup wurde im Jahr 1733 eröffnet, eine Mädchenschule erfolgte 1890. Anschluss an die Eisenbahn erhielt Hiltrup im Jahr 1848, als die Münster-Hammer Eisenbahn-Gesellschaft den Bau der Bahnstrecke Münster–Hamm fertigstellte. Die Eröffnung wurde am 26. Mai an der Bahnstation „Diecke Wief“ („Dickes Weib“), benannt nach der nahegelegenen Gaststätte „Dicke Wieve“, gefeiert. Zum 1. August 1868 wurde die Bahnstation verlegt und der neue Bahnhof Hiltrup eröffnet.

Die erste Feuerwehr erhielt Hiltrup 1892 mit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Hiltrup. Im Jahr 1894 gründete Pater Hubert Lickens vom Heiligsten Herzen Jesu ein Missionskloster am Roten Berg, das am 8. Dezember 1897 eingeweiht wurde. Ein entsprechender Frauenorden wurde am 25. März 1900 gegründet; die „Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu von Hiltrup“ gründeten im Jahr 1964 das Herz-Jesu-Krankenhaus.Am 11. August 1899 erhielt Hiltrup mit der Eröffnung des Dortmund-Ems-Kanals einen weiteren Verkehrsanschluss. Vier Jahre später baute Max Winkelmann in Hiltrup eine Zweigstelle von Glasurit, die später zum Hauptsitz und nach dem Verkauf an BASF im Jahr 1965 sowie der Umbenennung in BASF Coatings zu einem der bedeutendsten Lackhersteller der Welt werden sollte. Zu den weiteren wichtigen Bauwerken vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges zählen der Bau des Wasserwerks in der Hohen Ward im Jahr 1907 und die 1913 geweihte große Clemenskirche an der heutigen Marktallee. Bedingt durch den weiteren Ausbau der Eisenbahn und dem dafür benötigten Sand zum Aufschütten der Bahndämme entstand im Süden von Hiltrup der nach seinem ersten Pächter benannte Steiner See, der heute unter dem Namen Hiltruper See als Naherholungsgebiet fungiert.

Die erste bedeutende Unternehmensgründung nach Ende des Ersten Weltkrieges war die Gründung des Hiltruper Kalksandsteinwerkes durch Leo Schencking im Jahr 1928. In dessen Villa sollte im Jahr 1948 der zwei Jahre zuvor gegründete Landwirtschaftsverlag Münster einziehen. Ein weiterer wichtiger Bau war die Errichtung der ersten evangelischen Kirche an der Hohen Geest im Jahr 1932.Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde im Juli 1945 die Polizei-Führungsakademie eröffnet, z.T. untergebracht in einem, mitte der dreißiger Jahre errichteten Gestapo-Quartier, die seit dem 1. März 2006 unter geändertem Statut in Deutsche Hochschule der Polizei umbenannt wurde. 1956 wurde die katholische Kirche St. Marien eingeweiht. Neun Jahre später, im Jahr 1965, bekam Hiltrup sein offizielles Wappen verliehen: Es zeigt einen roten Anker und ein rotes Sonnenrad auf gelbem Hintergrund. Im Jahr 1970 wurde die zweite evangelische Kirche in Hiltrup eingesegnet, die Christuskirche an der Hülsebrockstraße. Zwei Jahre später erfolgte die Einsegnung des „Waldfriedhofs Hohe Ward“.Eine besondere Bedeutung hatten die 1970er Jahre für Hiltrup in politischer Hinsicht: Zum einen begann im Jahr 1974 die Städtepartnerschaft mit Beaugency in Frankreich, zum anderen verlor Hiltrup zum 1. Januar 1975 im Zuge der Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen seine Selbständigkeit und wurde in die Stadt Münster eingemeindet.

Im Jahr 1980 wurde die Hiltruper Stadthalle fertiggestellt. Sie ist neben der Halle Münsterland ein Veranstaltungsort für größere Veranstaltungen in Münster. Vier Jahre später erfolgte zum 1. September 1984 die Eröffnung des Hiltruper Museums in der alten Dampfmühle. Mit dem Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals zur Jahrtausendwende war auch der Neubau der Kanalbrücken notwendig. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2001 die zu diesem Zeitpunkt weltgrößte Stabbogeneisenbahnbrücke für die Bahnstrecke Münster–Hamm eingeschwommen.Im Jahr 2002 wurden die Rockwool-Werke, einer der wichtigsten Arbeitgeber in Hiltrup, geschlossen. Die letzte Schicht endete am 12. Juni 2002. 2003 erfolgte die Eröffnung des Bait ul-Mo’min, der ersten Moschee Münsters. Seit dem 1. März 2006 verfügt Hiltrup mit der Deutschen Hochschule der Polizei über eine eigene Hochschule. Sie ist auf Beschluss des nordrhein-westfälischen Landtages aus der ehemaligen Polizei-Führungsakademie hervorgegangen.