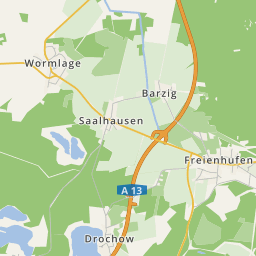

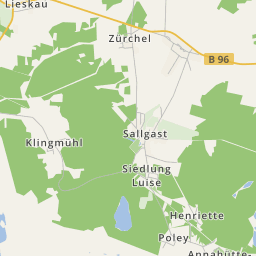
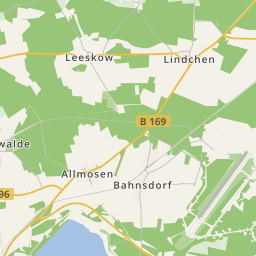


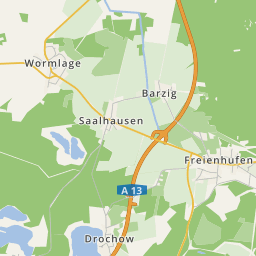

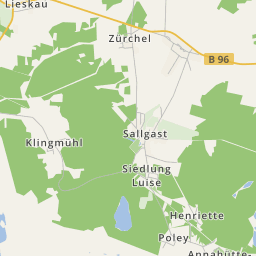
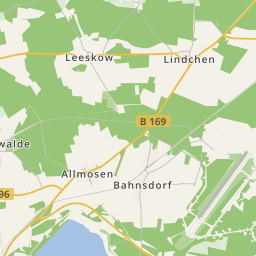


Sassleben
Wie die Reste eines noch aus slawischer Zeit stammenden Burgwalls in Saßleben zeigen, war der Ort seit langem besiedelt.Um 1350 saß hier ein Zweig des schon damals in der Niederlausitz weit verbreiteten Geschlechts von Löben. Der Ortsname geht auf das sorbische „Saslomen" zurück und bedeutet „Ort, der gutes Stroh liefert".
1911 gelangte das Rittergut in den Besitz des jüdischen Kaufmanns Georg Wertheim. Er schenkte es seiner Frau zur Geburt seines Sohnes.
Das Schloss brannte 1945 nieder, nur einige Stallgebäude sind erhalten geblieben.

Die Parkanlage muss als eine der bedeutendsten in der Region angesehen werden. Sie ist mit den Teichen etwa in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt
worden und umfasste rund
14 Hektar. Die Bootsanlegestelle und der Inselpavillon wurden 1924/1925 fertig gestellt. Die vier Karyatiden des Pavillons symbolisieren die vier Jahreszeiten.
Die Kirche wurde im 15. Jahrhundert erbaut, 1775 erfolgte ein grundlegender Umbau, bei dem wahrscheinlich auch der kleine hölzerne Glockenstuhl errichtet wurde. Die 1813 von dem Saß-lebener Müllermeister Johann Friedrich Krüger gestiftete Orgel wurde 1928 durch eine neue ersetzt.
Gleich am Ortseingang an der Straße von Calau befindet sich die aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts stammende Dorfschmiede, ein klassizistischer Bau ländlicher Industriearchitektur, heute technisches Denkmal.
Dem gegenüber lädt die Gaststätte „Zur Rose" schon über mehrere Generationen zur Einkehr.
Kalkwitz
Nachweislich hatten die Familien Köckritz und von Zieckau schon 1460 gleichzeitig Besitz im Dorf. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1495 in einer Matrikel des Bistums Meißen.
Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Rittergut fast völlig verwüstet, 1756 brannte es bis auf drei Häuser nieder.
Kalkwitz war bis 1816 eine brandenburgische Enklave, umgeben vom sächsischen Markgraftum Niederlausitz.
1829 übernahmen die Grafen zu Lynar die Gutsherrschaft.
Die ursprünglich gotische Kirche wurde im frühen 15. Jahrhundert erbaut. Aus dieser Zeit sind noch die Wandmalereien und der Fußboden aus Lesesteinen erhalten.
Der Umbau im 18. Jahrhundert im Stil des Barock hat ihr ihre heutige Gestalt verliehen.
Der Turm ist nachträglich angebaut worden. Bis auf das Fundament besteht er vollkommen aus Holz einschließlich der Holzschindeleindeckung.
Auf Grund ihres schlechten baulichen Zustandes konnte die Kirche fast 20 Jahre nicht mehr genutzt werden. Erst am 07.05.1995 war nach vierjähriger Bauzeit die Wiedereinweihung möglich.
Bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts war Kalkwitz für die riesige Obstplantage bekannt.
Heute hat sich der Spargelhof „Carina" über die Ortsgrenze hinaus einen Namen gemacht.
Ein Unternehmen mit langjähriger Familientradition ist auch der „Treppenbau Droge".
Reuden
Reuden wird lange Zeit in Verbindung mit Plieskendorf genannt. Obwohl räumlich nicht beisammen liegend, befanden sich beide Dörfer in einer Hand.
Als älteste Besitzer sind um die Mitte des 15. Jahrhunderts die von Zabeltitz erwähnt, die sicher aber schon viel früher in Reuden ansässig waren. Plieskendorf kommt erst in Urkunden aus den 70er Jahren des 16. Jahrhunderts vor, dann aber bereits in Verbindung mit Reuden.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Reuden und Plieskendorf getrennt verkauft, das Rittergut Reuden am 01.04.1900 an Gehard Lindner, 1907 wird Eugen Wolf aus Buchwäldchen als Besitzer von Plieskendorf genannt.
Der Boden rund um Reuden ist von hervorragender Qualität, sodass man sich um 1920 auf die Zucht von Merinoschafen und schwarzbunten Ostfriesen-Rindern spezialisierte.
Nach 1945 entstand daraus das Volksgut Reuden.
Die Gutskapelle, ein für diese Region einmaliges barockes Bauwerk, wurde 1729 eingeweiht. Der Bauherr, Otto Bernhard von Borcke, war in Dresden tätig und ließ sich von dem dortigen Baugeschehen anregen. Leitende Dresdner Bauleute werden in dieser Zeit auch in den Kirchenbüchern als Paten Reudener Kinder genannt.
1997 begannen, initiiert durch den Förderverein Gutskapelle Reuden e.V., die Sanierungsarbeiten an dem lange Jahre dem Verfall preisgegebenen Gebäude. Sie wurden überwiegend durch Fördermittel und Spenden realisiert und 2003 weitestgehend abgeschlossen.